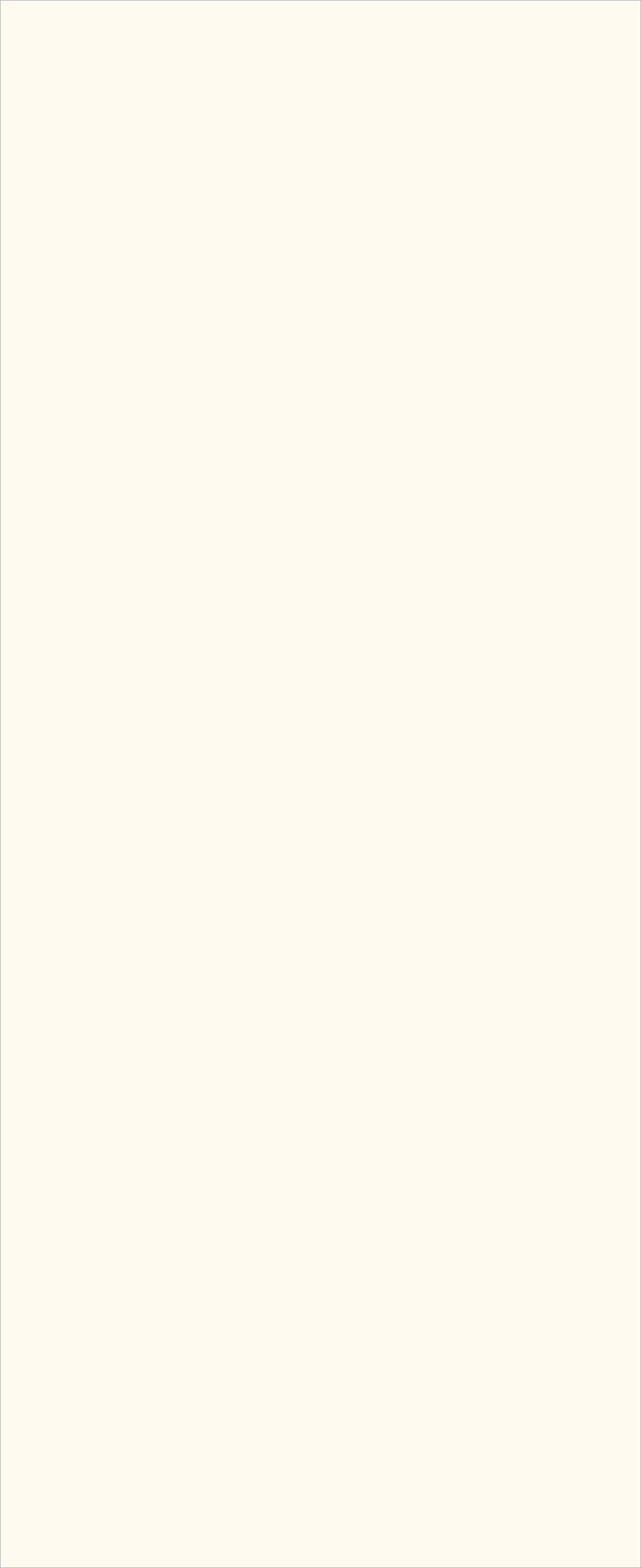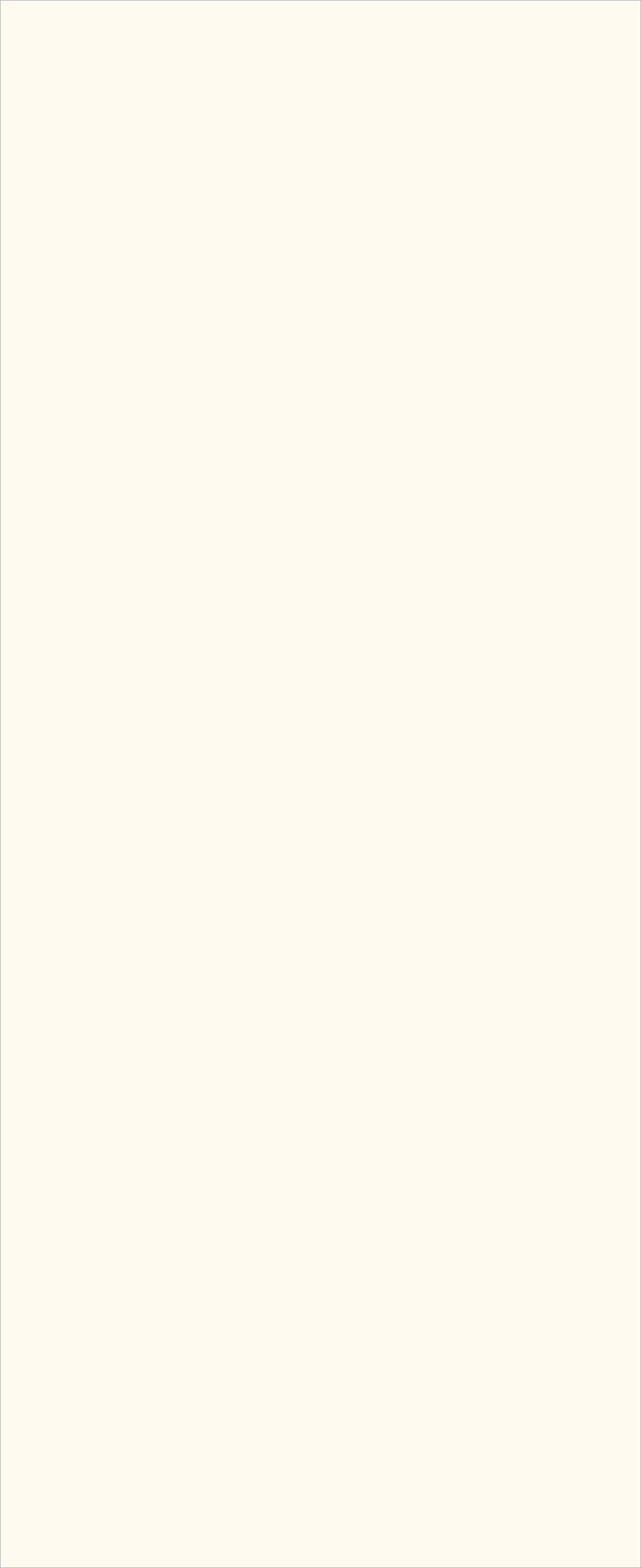Fotos: Wolfgang Broemser
Umgebautes Schiefermahlwerk, Kaub; neues Kulturhaus Oberwesel
Architekten: Peter Kummermehr (Kaub), Hubertus Jäckel (Oberwesel)
Bauzeit: 2002-2008
Architekturen // Revitalisierung
Gute Architekten stiften gute Ehen
"Die Zahl der Trauungen hat nicht zugenommen. Aber die bei uns
geschlossenen Ehen sind haltbarer." Die Leiterin des Kulturhauses
Das Zentrum von Oberwesel enthält seit kurzem ein Kulturhaus mit einem Museum zur
Stadtgeschichte und multifunktionalen Räumen für kulturelle Veranstaltungen. Dafür
wurde ein denkmalgeschütztes Weingut aus dem Jahr 1868 vollständig saniert und
an Stelle der abbruchreifen Wirtschaftsgebäude ein moderner Anbau geschaffen. Ein
zweigeschossiger, gläserner Luftraum verbindet die beiden Gebäude.
Multimedial & barrierefrei
Es entstand eine gelungene Synthese von historischem Backsteinhaus und moderner
Architektur. Alle Ebenen und Räume einschließlich des Gewölbekellers sind barrierefrei
erschlossen und dank umfangreicher technischer Ausstattung multimedial nutzbar.
Der Saal des Kulturhauses bietet Platz für bis zu hundert Personen.
In dem stilvollen Ensemble sind auch Firmen- und Privatfeiern sowie standesamtliche
Trauungen möglich. Träger der Einrichtung ist die private Kulturstiftung zweier
Ehrenbürger aus Oberwesel.


Wohnungen & Zement-Art
Das im Ortskern von Kaub gelegene Schiefermahlwerk lag seit seiner Schließung
1975 brach. Auf Grund der attraktiven Lage beschlossen die neuen Eigentümer, das
denkmalgeschützte Gebäude mit der charakteristischen Bruchsteinfassade für Wohn-
und Gewerbezwecke umzubauen. Dank ideenreicher Detaillösungen und der qualität-
vollen Gestaltung der Außenanlagen ist das Ergebnis sehenswert. Der Umbau revita-
lisiert ungenutzte Bausubstanz in einer historischen Ortslage und wertet die Ufer-
silhouette von Kaub auf.
Eine in dem umgewandelten Industriebau ansässige Firma produziert und vermarktet
Fliesen und Mosaikplatten aus Zement, mit denen auch das Gebäude ausgestattet ist.
Das hier hergestellte Produkt und das Haus bilden eine eindrucksvolle Symbiose.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Die Jury des "Wettbewerbs Baukultur" hat erneut vorbildliches Bauen im Welterbe Oberes Mittelrheintal aus-
gezeichnet. Zwölf Objekte wurden prämiert - eine stolze Zahl für eine Region, die als "Architektur-Diaspora"
gilt. Trotzdem liefern die beiden obigen Projekte gelungene Beispiele für das Bauen im Bestand, das heute
als ökologisch und ökonomisch klüger, weil nachhaltiger propagiert wird als Abriss und Neubau. Neben der
lässt sich ein Bestandsbau so sanieren, dass er wie ein Neubau aussieht, auch wenn große Teile des alten
Gebäudes erhalten bleiben. Mit ihr kann recycelter Bauschutt für den Umbau genutzt und in den Kreislauf des
Bauens zurückgeführt werden. Das Ausschlachten des Bestandes als Rohstofflager spart tonnenweise Kohlen-
dioxid ein und verlängert die Lebensspanne einer Immobilie. Und kann das Praktische, das Nachhaltige und
das Schöne verbinden in einem grünen Hedonismus, der den Luxus anpasst an die Krise und die Krise an den
Luxus, wie das verlinkte Projekt in der Stuttgarter Königstraße zeigt.
In Städten mit großer Wohnungsnot kommt man jedoch um Neubau nicht herum. Hier meint intelligente
Konversion die Neubebauung brachgefallener Flächen mit Ensembles, die, wie das Löwitz-Quartier in Leipzig
oder das Lichtenrader Revier in Berlin, ökologisch nachhaltig und sozial durchmischt sind, eine Stadt oder
Stadtlage architektonisch aufwerten und sie durch Neubürger ökonomisch stärken. Eine solche Konversion in
großem Stil könnte sich bald auch am Mittelrhein ereignen, mit der Umwandlung der Löhnberger Mühle in
Niederlahnstein in ein Wohnquartier mit dem zeitgemäß-schnittigen Label "Rhein-Lahn-Living". Allerdings
droht das Projekt aufgrund des Insolvenzchaos bei dem Berliner Entwickler, der dahintersteht, zu scheitern.
Nach Signa und der Gerch Group hat die Immobilienkrise in der Gröner Group ihr drittes prominentes
Opfer gefunden...
"Höhlen-Baukultur am Mittelrhein? Nicht, solange Güterzüge durch das
Tal donnern. Flüsterbremsen sind das Mindeste, Herr Schienenchef!"
"Hey, wir buddeln einfach die Gleise aus, Bruder! Gegen unsere
Kernkompetenz sind alle Schienenchefs machtlos."
Weingut & Schiefermahlwerk
Anhänger finden immer
mehr Anhänger.
*) Laut einem Gutachten des
Instituts der deutschen Wirtschaft
von 2019 verharrt die Wohneigen-
tumsquote bei 45 Prozent. Der
Bau oder Erwerb von Häusern ist
wegen gestiegener Baukosten,
Zinsen, Grunderwerbssteuern und
Notargebühren heute so teuer,
dass die meisten ihn sich nicht
mehr leisten können. Das ist
schade, denn es gilt: Man lebt
nur richtig, wenn man das Leben
als Abenteuer erlebt. Und Bauen
macht das Leben abenteuerlich -
dem Fels in der Brandung, dem
eigenen Heim, geht die Brandung
voraus, und die gesteigerte Bran-
dung ist das architektonisch am-
bitionierte Bauen. Bleibt dieses
aber unerschwinglich, stellt sich
ein Gefühl des Betrogenseins ein
- das Interesse an Architektur
erlischt, aber womöglich auch
die Identifikation mit dem eige-
nen Land und seiner zentralen
Errungenschaft, der Demokratie.
"Baukultur ist eine Sache aller,
ob Hauseigentümer, Bewohner,
Architekten, Touristen, Investoren,
Unternehmer, Politiker oder Hand-
werker: Alle tragen Verantwortung
für eine anspruchsvolle bauliche
Entwicklung des Unesco Welterbes
Oberes Mittelrheintal."
Initiative Baukultur
Baukultur geht alle an, weil die
gebaute Umwelt die Umwelt aller
ist - daher müsste das Interesse
an Architektur eigentlich flächen-
deckend sein. Zumal die Teilhabe
an Baukultur nicht davon abhängt,
ob man Mieter oder Hauseigen-
tümer ist.** Entscheidend ist viel-
mehr die Identifikation mit dem
Ort, die über die Wohndauer er-
zeugt wird. Häufiger Wohnort-
wechsel wegen (erzwungener)
beruflicher Mobilität behindert
dagegen Identifikation und da-
mit das Engagement für bes-
seres Bauen.
**) Die Mieternation Deutsch-
land ist Resultat einer Erziehung,
die zu allem Möglichen, nur nicht
zu Selbstverantwortung, Ehrgeiz
und Leistungswillen, erzieht - zu
"rechts" (die rotgrüne Erziehung
von heute), zu "kulturlos-materia-
listisch" (die humanistische Er-
ziehung von ehedem, von der
noch der Autor "profitierte").