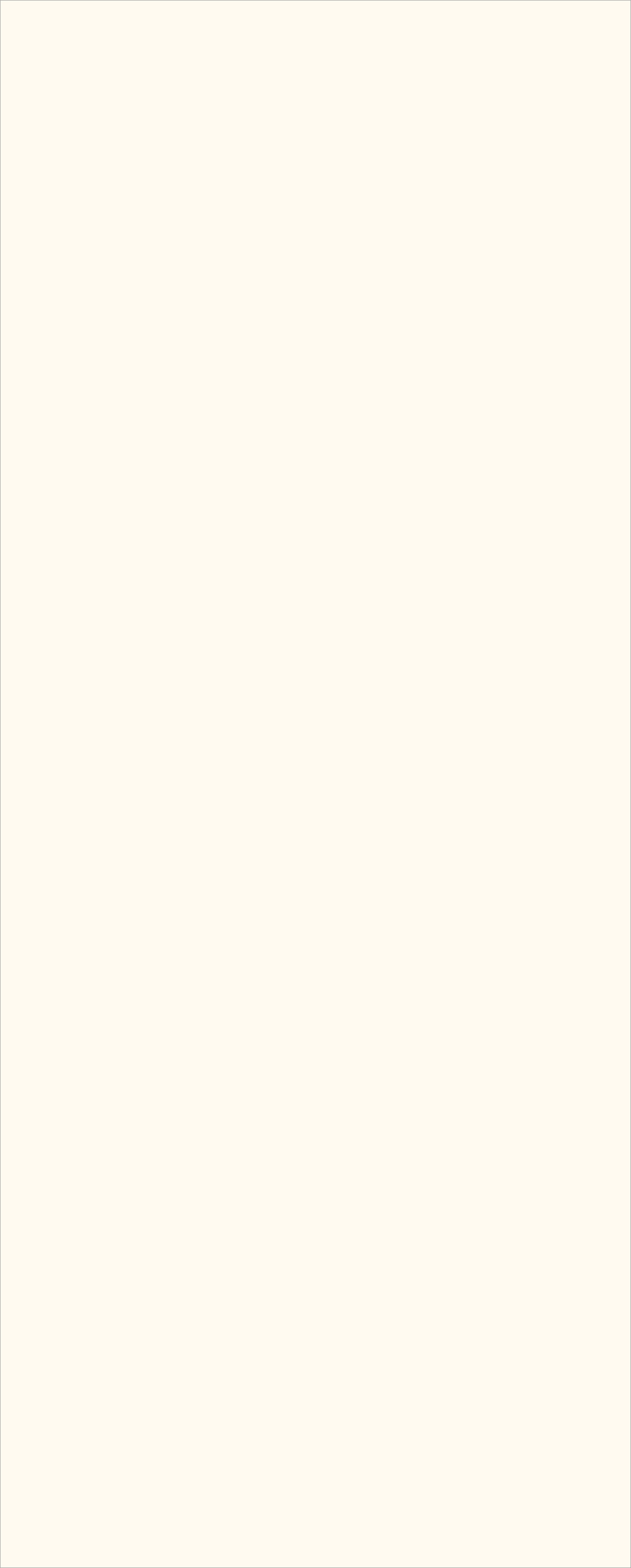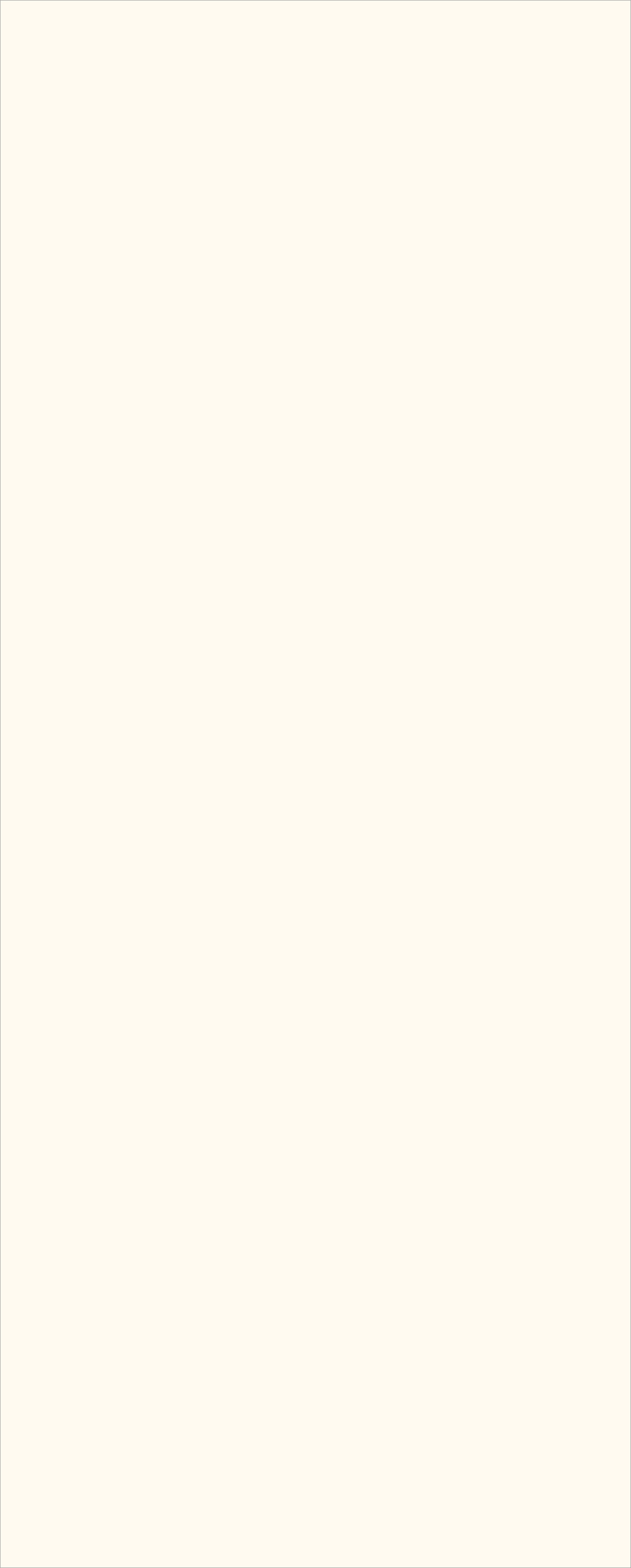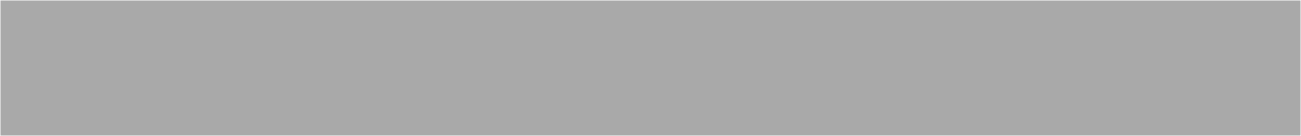Fotos: Wolfgang Broemser
Gemeindezentrum der Evangelischen Freikirche, Andernach
Architekt: Norberto A. Gergaut (Andernach)
Bauzeit: 2006-2011
Architekturen // Freikirche
Mit "Muskelhypothek" und Gottes Führung
"Sakrale Bauwerke gehören zu den schönsten Bauaufgaben
des Architekten." Holger Zimmermann, M+ architekten
Evangelische Freikirche
Gotteshäuser bieten nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern öffnen auch das Tor
zum Übernatürlichen - daher darf und muss hier auch die Architektur "übernatürlich"
sein. So wie Religion das Profane transzendiert, ist sakrale Architektur aufgerufen, nicht
nur Raum zu umbauen, sondern Raum zum Sprechen zu bringen, Gebautes zum Träger
einer Botschaft zu machen, die das Gebaute über sich hinausweisen lässt. Jeder Archi-
tekt strebt insgeheim nach den Sternen, möchte die Erdenschwere von Wohnungen,
Kitas, Büros hinter sich lassen, so wie ein Schauspieler auch einmal in Hollywood,
nicht nur im "Tatort", eine Rolle spielen will.
Verwandeltes Gewerbegebiet
Im Andernacher Füllscheuerweg haben die Taufgesinnten der Evangelischen Freikirche
in viereinhalb Jahren mit viel Eigenleistung ihr neues Gottesdienstgebäude errichtet.
Es gelang ihnen, ein tristes Gewerbegebiet mit einem Zeichen zu versehen. Dazu trug
entscheidend die Architektur mit ihrer schlichten, aber eindringlichen Symbolik bei.
Norberto A. Gergaut, der Planer, entwarf im Team von Mechthild Heil fast gleich-

Foto: epd/S. Wallocha
Klare Zonierung des Bauwerks
Die einzelnen Teile des vielfach gegliederten Bauwerks sind farblich und volumenmäßig
klar voneinander abgegrenzt. Der geostete Gemeinderaum überragt als wichtigster Teil
mit einem Pultdach das übrige Ensemble. Die Mittelachse enthält Speisesaal und Küche,
der westliche Teil Kinder- und Jugendräume. Räume für Gebetstreffen, Hauskreise und
Glaubenskurse sind an der Nordseite angegliedert.
Rückkehr zum frühen Christentum
Der Neubau ist als öffentliches Gebäude, als Brücke zu Gott und den Menschen, konzi-
piert. Seine Baumaterialien werden vorgezeigt und damit aufgewertet. Das Sichtmauer-
werk des Gottesdienstraums besteht aus einheimischem Bimsstein. Elegant und zugleich
kostensparend ist die Decke aus Leimbindern und Trapezblechen. Schlicht und urprüng-
lich wirken auch die Stützen aus Stahlbeton und die erdfarbenen Bodenfliesen. Diese
Einfachheit reflektiert den Willen der Gemeinde, mit der Glaubenstaufe an das frühe
Christentum anzuknüpfen. Der Taufe dient ein im Boden versenktes Becken, in das
eine Treppe führt.
Das Zeichen des Kreuzes
Licht fällt in den Gemeindesaal hauptsächlich durch ein Fenster in der Ostspitze. Seine
Sprossen bilden ein Kreuz, das bei entsprechenden Wetterverhältnissen einen Schatten
auf die gegenüberliegende Wand wirft - das einzige Zeichen in einem schmucklosen
Umfeld, in dem nur das Wort Gottes und die persönliche Entscheidung für den Glau-
ben, die beiden größten Geschenke des Lebens, zählen.
"Erdmännchen und Religion? Warum nicht - wenn´s im Himmel
genug Skorpione gibt und keine bösen Vögel..."
"Sorry, Bruder, aber für uns wäre der Himmel bestimmt die Hölle!"
Bauen für den größten aller Bau-
meister ist selten heute, aber dann
meist preisverdächtig: so zu sehen
an der A 45 bei Wilnsdorf oder der
ersten neuerbauten Kirche in Ost-
deutschland seit der Wiederver-
Die Kirche als Institution mag
heute nicht besonders attraktiv
sein; der Neubau einer Kirche ist
dagegen hochattraktiv - Laien er-
leben den Vorgang offenbar wie
die realisierte Utopie eines Neu-
baus der Kirche "von unten".
Mit Blick auf ostdeutsche Städte
spricht die "Neue Zürcher Zeitung"
von "einer Blüte der Synagogen-
Architektur in Deutschland". In
Dresden, Chemnitz und Schwerin
entstanden neue jüdische Bet-
und Gemeindehäuser, gefördert
durch Landeszuschüsse und
private Spenden. Neue Synagogen
kehrten auch in die Innenstädte
von Potsdam, Magdeburg und
Dessau zurück. Gründe für den
sakralen Bauboom sind die durch
den Zustrom von Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion ange-
wachsenen Gemeinden und der
Wille der Deutschen zur Wieder-
gutmachung - wichtiger denn je
in einer Zeit, da Juden empfohlen
wird, in der Öffentlichkeit auf das
Tragen einer Kippa zu verzichten!
"Denn wer baut, der bleibt. Und das
haben wir fest vor." Josef Schuster,
Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland, bei der Grundstein-
legung der Synagoge in Potsdam
Viel Aufmerksamkeit erregt auch
erstmals eine Moschee, Synagoge
und Kirche unter einem Dach ver-
einen will. Die Baukosten teilen
sich der Bund, das Land Berlin und
Spender aus aller Welt. Getragen
wird das Projekt von religiösen
Vereinen der Hauptstadt. Ent-
steht hier vielleicht ein Ort der
Aussöhnung, auf den die Welt
blickt, ein utopischer Superlativ
ohnegleichen, der alle Ansprüche
Berlins an sich selbst rechtfertigt?
Der Architektur würde dabei die
schöne Rolle zuteil, einer Ver-
besserung des gesellschaftlichen
Klimas buchstäblich Raum zu
geben.
© Kuehn Malvezzi